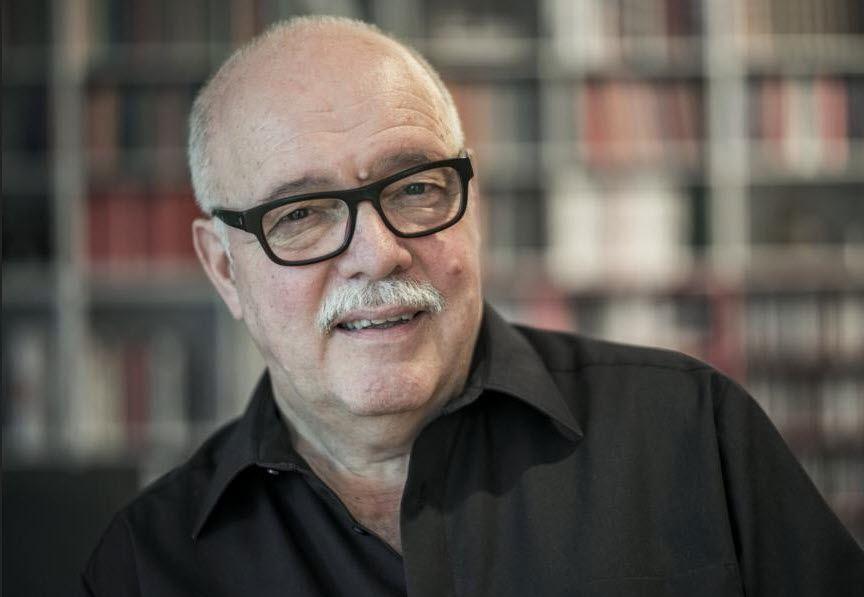Kriegsmedizin in Friedenszeiten
Haben wir ein Triage-Gesetz wirklich gebraucht?
Was tun, wenn eine Pandemie zu einem massenhaften Ansturm von Erkrankten führt, der die Kapazitäten unseres Gesundheitswesens übersteigt? Muss man dann Schwerkranken die Behandlung vorenthalten, weil die medizinischen Ressourcen für die aussichtsreicheren Fälle gebraucht werden? Dr. Hontschik sagt klar, dass eine Triage im Katastrophenfall undurchführbar ist. Stattdessen plädiert er für das Randomisieren.
Im 19. Jahrhundert starben auf den Schlachtfeldern der napoleonischen Feldzüge 3,5 Millionen Soldaten. Der französische Armeechirurg und Leibarzt Napoleons Dominique Jean Larrey (1766 – 1842) war auf allen Schlachtfeldern dabei. Er erfand die „fliegenden Lazarette“ zur Sofortversorgung der Verwundeten auf dem Schlachtfeld, er entwickelte neue, schnelle Amputationstechniken, und er erfand die Triage. Mit der Triage (franz. trier: aussortieren oder aussuchen) wurden die Verletzten nach der Schwere ihrer Verwundung sortiert, um möglichst viele zu retten und möglichst rasch wieder zurück an die Front schicken zu können. Larrey gilt seither als Begründer einer modernen Kriegschirurgie.
Triage ist die Abkehr vom ehernen Grundprinzip der Medizin, zuerst dort zu helfen, wo Hilfe am nötigsten gebraucht wird. Triage zielt auf den größtmöglichen Nutzen für Viele, nicht für Einzelne. Im zivilen Leben kommt die Triage nur dann in die Diskussion, wenn große Katastrophen zu einem überwältigend großen Anfall von Erkrankten oder Verletzten führen, etwa durch ein Unglück. Etwa 60 km nordöstlich von Hannover ereignete sich am 3. Juni 1998 das bis dahin schwerste Zugunglück in der Geschichte Deutschlands. Der ICE 884 „Wilhelm Conrad Röntgen“ entgleiste, 101 Reisende kamen ums Leben, 70 wurden schwer verletzt. Zufällig fand zur selben Zeit im nahen Hannover eine Tagung von Unfallchirurgen statt, die alles stehen und liegen ließen und zu dem Unfallort eilten. Mit Sicherheit haben sie alle mehrfach entscheiden müssen, wem sie sofort helfen, wem später und wem gar nicht, bis endlich der ganze große Rettungsapparat vor Ort eingetroffen war. Diese Katastrophe war lange ein großes Thema, aber über Triage hat damals niemand diskutiert.
Ich habe als Chirurg nur ein einziges Mal eine annähernd vergleichbare Situation erlebt: Vor 40 Jahren, am 3. Juni 1983 gehörte ich im Krankenhaus Höchst zur Notarztwagenbesatzung. Wir wurden alarmiert und erhielten nur spärliche Angaben über unseren Einsatzort, eine Schule im Vordertaunus. Dort seien Schüsse gefallen. Als wir auf den Schulhof einbogen, fielen immer noch Schüsse, wir gingen in Deckung. Plötzlich wurde es laut, der Himmel verdunkelte sich, SEK-Polizisten seilten sich von Hubschraubern ab und stürmten in das Schulgebäude. Die Schüsse hörten auf, wir wurden gerufen, der Schütze war tot. Wir rannten in eines der Klassenzimmer, alles war voller Blut. Dort lagen Kinder, tot, schwer verletzt, unverletzt. Immer mehr Rettungskräfte trafen ein. Der Amokschütze hatte fünf Menschen getötet und 14 zum Teil schwer verletzt, bevor er sich selbst in den Kopf schoss. In der Eile deckten wir die Toten zu, schickten die Unverletzten hinaus und untersuchten die Verletzten. Zum Glück waren rasch weitere Rettungskräfte eingetroffen. Eine anfangs drohende Triage war nicht mehr nötig.
Die apokalyptischen Bilder der sargbeladenen LKWs in Bergamo, der Massengräber in Manhattan und der sterbenden Kranken vor den Türen indischer Kliniken haben die Triage nachhaltig in unser aller Bewusstsein gehoben. Was tun, wenn die Pandemie zu einem massenhaften Ansturm von Erkrankten führt, der die Kapazitäten unseres Gesundheitswesens übersteigt? Muss man dann Schwerkranken die Behandlung vorenthalten, weil die medizinischen Ressourcen für die aussichtsreicheren Fälle gebraucht werden?
Unter dem Druck dieser Pandemie hat der Deutsche Bundestag im November 2022 ein „Verfahren im Falle nicht ausreichender überlebenswichtiger intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten“ als Teil des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet, in dem das zentrale Entscheidungskriterium über Leben und Tod „aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit“ lautet. Die Entscheidung solle nach dem Mehraugenprinzip fallen. Sind Menschen mit Behinderung von Triage betroffen, müsse „Fachexpertise“ eingeholt werden, selbstverständlich mit gerichtsfester Dokumentation. Ein Triage-Gesetz gibt es nirgendwo sonst in Europa – außer jetzt in Deutschland.
Dieses Gesetz ist realitätsfern und im Katastrophenfall undurchführbar. Aus meiner Sicht ist nur eine einzige Methode denkbar, die die Brutalität der Entscheidung von Willkür und Fehlern befreit und die Beteiligten der Gewissenskonflikte und Schuldgefühle enthebt. Das ist das Randomisieren. Umgangssprachlich nennt man das Verlosen. Das Resultat einer Losentscheidung ist nicht gerecht. Es ist in seinen Auswirkungen genau so brutal wie jedes andere Auslesekriterium auch. Aber es ist sauber, nachvollziehbar und frei von subjektiven oder unbewussten Kriterien. Nur beim Verlosen spielen Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Korruption, sozialer Status und Behinderungen keine Rolle. Randomisieren befreit die Beteiligten von der Verantwortung und dem moralischen Druck, etwas entscheiden zu müssen, was niemand entscheiden kann.